Die Logik der Gamification
von Jonas Kellermeyer
29.04.2025
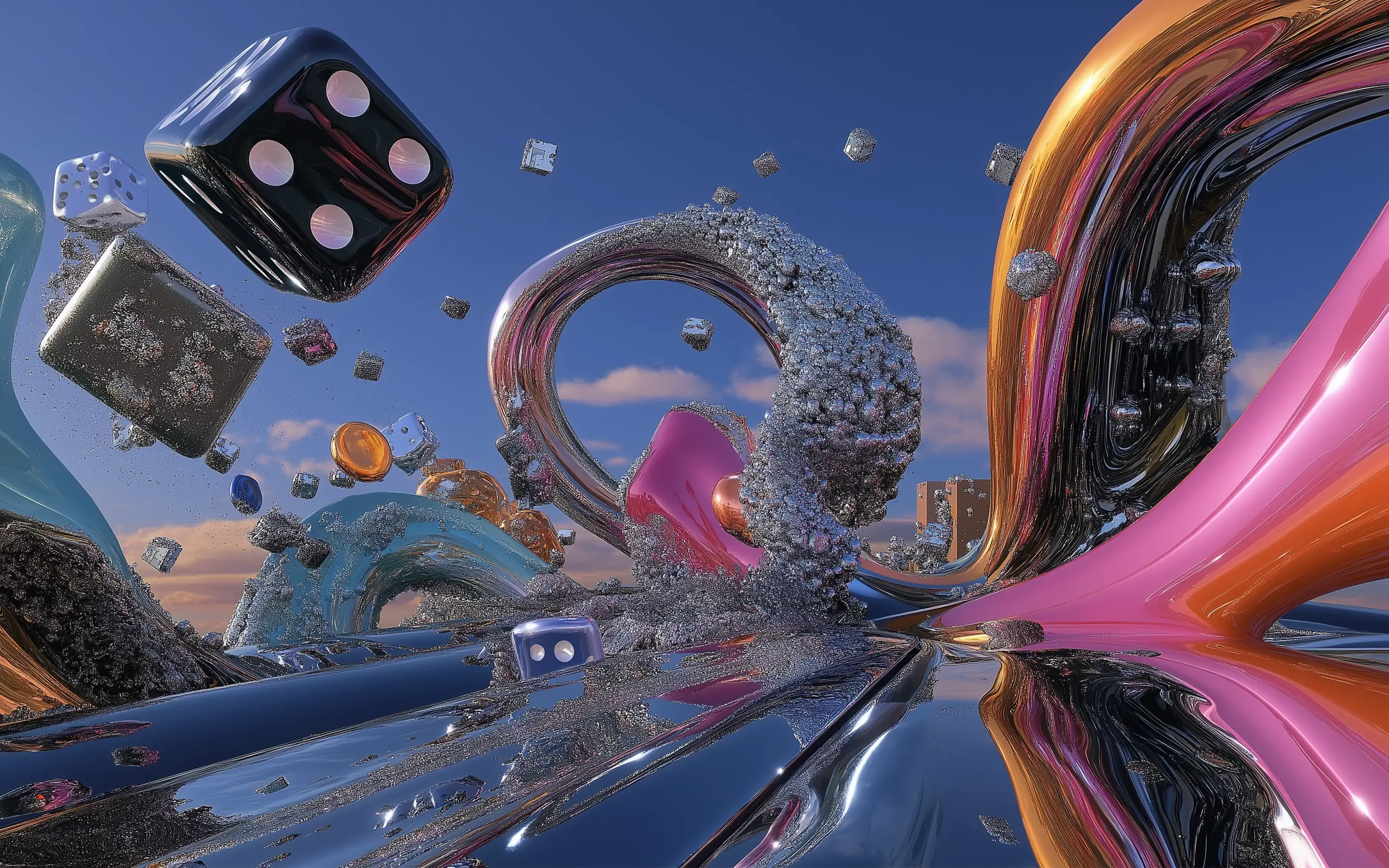
Wenn wir an Computerspiele und die Logiken denken, die in ihnen am Werk sind, verbinden wir diese oft mit reiner Freizeitbeschäftigung. Doch zunehmend zeigt sich, dass explizite Spielmechanismen auch in ganz andere Lebensbereiche diffundieren; Gaming findet also längst nicht mehr nur in abgeschlossenen Räumen statt. Diese Entwicklung ist Anlass genug, den Trend der anhaltenden Gamification – oder der Ludification – und seine Auswirkungen auf unsere Lebenswelt näher zu betrachten.
Game on, Game off, Game over
Wo wir hinblicken, sehen wir spielerische Mechanismen am Werk: Statūs, die durch zu füllende Anzeigebalken und/oder andere UI-Elemente erfahrbar gerendert werden, über sogenannte Streaks, die kontinuierliche Nutzung belohnen, bis hin zu bunten Badges, die als Ausweis von Exzellenz zur Schau gestellt werden können, finden sich in vielen Bereichen der heutigen Wirtschaftswelt entsprechende Beispiele.
Im Folgenden soll der Begriff des Spiels dementsprechend weiter gefasst werden. Sybille Krämer (2005) bietet eine einleuchtende Definition an: “Spiel ist, was sich in der Gegenwart seines Vollzugs dem Fluss des ‘gewöhnlichen’ Lebens entzieht” (Krämer 2005: 13). Hiermit wird der Vielfalt an Möglichkeiten der exakten Ausgestaltung Rechnung getragen. Das Spiel eröffnet also eine fiktive Realität, die es allerdings erfordert sich gänzlich auf sie einzulassen, nicht stets den fiktiven Charakter des Gefüges zu betonen. Der Spielverderber ist eben nicht derjenige, der sich mit dem jeweiligen Zusammenhang (über-)identifiziert, sondern derjenige, der stets zu betonen weiß, dass es sich bei dem Spiel nicht um die Realität handelt. Derjenige also, der ein (temporäres) Eintauchen mit relativierenden Einwänden zu verhindern weiß. Er ist ein Individuum, das mit der Konvention bricht, derzufolge, für die Dauer des Spiels, dieses sehr wohl als “ernste Angelegenheit” in Erscheinung zu treten vermag. So ist auch ein guter Schauspieler ein solcher, der darum weiß die Illusion der Ernsthaftigkeit zu perfektionieren und sein Publikum in den Bann zieht, sich bei alledem aber (paradoxer Weise) der Fiktion als solcher bewusst ist.
Nimmt man also diesen Sachverhalt als solchen ernst, wird offensichtlich, dass verschiedene Spielmechanismen und Besonderheiten im Regelwerk eine Schlüsselrolle im Vollzug des quasi-fiktiven/quasi-realistischen Aktes darstellen. Das Würfelspiel lebt von der stochastischen Zufälligkeit der Möglichkeiten. Jede Zahl besitzt dieselbe Wahrscheinlichkeit gewürfelt zu werden: Klassischerweise 1/6. Dadurch bringt der Einsatz eines Würfels ein willkürliches Element in den Spielverlauf ein, was Taktik zwar nicht ausschließt, allerdings eine immanente Kontingenz manifest werden lässt. Der Umgang mit Würfeln lehrt den Würfelnden also im besten Falle etwas die Welt konstituierende, stochastische Entropie betreffend (vgl. Serres 1998).
Die Fiktion bezeichnet vom Wort her schon etwas gemachtes, eine Konstruktion, was sie gleichsam mit dem so überstrapazipierten Begriff der Fakten verbindet. Das Spiel gelingt dann, wenn sich die jeweiligen Regeln intersubjektiv zu verwirklichen beginnen. Wenn sich also die Welt der Kontrahenten oder Kollaborateure punktuell zusammenzieht und — samt Sinn — am Maßstab des Regelwerks zu kondensieren beginnt. Interessant wird es gerade dann, wenn in einem solchen Kontext andere Ziele als erstrebenswert gelten, als dies in der (“profanen”) Lebenswelt der Fall ist. Im Kontext des Spiels kann kann sich dieser Tatsache bedient werden, um Szenarien wie etwa das Risiko-Spiel auch solchen Leuten schmackhaft zu machen, die gemeinhin nichts mit imperialistischen Ambitionen anfangen können. Wenn also ganz bewusst mit den sonst als fix gesetzten (subjektiven) Annahmen gebrochen wird und die Teilnehmer des Spiels diese nicht als unzumutbar klassifizieren, dann gelingt es mitunter ein Spielerlebnis zu kreieren, bei dem Herausforderung — in vielerlei Hinsicht — zum Leitmotiv wird.
Spiele versprechen eine Struktur zu etablieren, die hinsichtlich der Produktivität positiv zu Buche zu schlagen vermag. Um ein klein wenig tiefer in die Materie einzusteigen, wollen wir uns im folgenden Abschnitt dieser sich im Spiel entfaltenden zweckdienlichen Dynamik näher widmen.
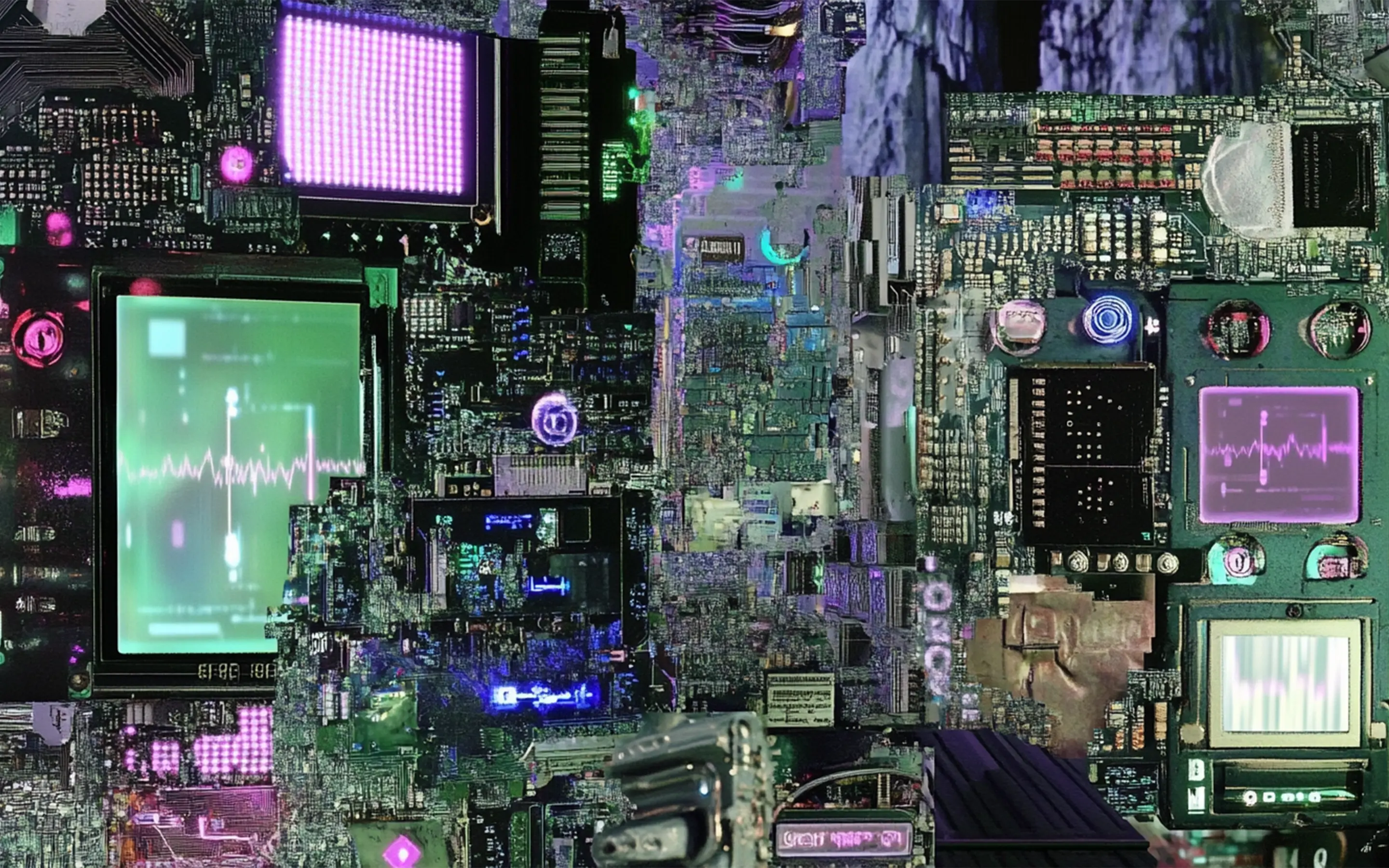
Über strukturierte Regeln und regelnde Strukturen
Versteht man das Spiel also als Modus in dem (frei von weltlichen Konsequenzen) geübt werden darf bzw. in dem Charakterzüge ausprobiert und mitunter verfestigt werden können, dann wird offensichtlich, dass die jeweils geltenden Regeln eines bestimmten Spiels mehr als bloß immanente Qualität besitzen, sondern von einer Wichtigkeit für das individuelle Dasein zeugen. Es erscheint als logische Konsequenz, dass eine solch identitätsstiftende Tätigkeit sich je nach sozioökonomischer/kultureller Differenz der beobachteten (und beobachtenden) Individuen unterschiedliche Ausprägungen haben kann und muss.
So merkt der römische Geschichtsschreiber Tacitus in seinem Opus Magnum “Germania” etwa an, die als barbarisch geltenden Germanen gäben sich von Zeit zu Zeit “merkwürdigerweise nüchtern” dem Würfelspiel hin, das sie als ernsthafte Tätigkeit betrieben. Die Absenz des substanzgebundenen Rausches machen sie Tacitus zufolge mit einem regelrechten Spielrausch wett: “im Gewinnen und Verlieren [sind sie] so unbeherrscht, dass sie, wenn sie nichts mehr haben im letzten Wurf ihre Freiheit und Person einsetzen”. Bei dieser proto-religiösen Rage scheint es sich um ein maßgebliches Merkmal der mentalen Prädisposition des Würfelspiels zu handeln. Alles oder nichts, das liegt letztlich in den (metaphorischen) Händen des Schicksals. Und genau dort soll es auch liegen. Es ist wichtig, dass quasi rational die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn errechnet werden kann, zugleich aber niemals 100 %ige Sicherheit besteht.
Ganz anders verhält es sich bei taktischen Spielen, wie etwa dem Schach. Dieses gleicht viel eher der Kriegsführung, die — nicht frei von einigem Zynismus — selber als “spielerisch” verstanden werden kann. Doch auch im Schachspiel taucht eine Figur des Zufalls auf: “‘Ribaldus’, eigentlich der Bauer im Schachspiel, gilt als Synonym des Spielers. Seine Attribute sind drei Würfel, die er mit der linken Hand in die Luft wirft. Zeichen dafür, dass er zum Spiel bereit ist” (Näther 2014: 6). Diese Spielfigur bietet eine Art entropisches Passe-Partout für die eigentlich im Fokus stehende klar strukturierte Taktik. Da die Figuren im Schachspiel letztlich gesellschaftliche Realitäten widerspiegeln, kann der Bauer als schicksalsergebene Gestalt gelten, deren Kraft fernab der Individualisierung in der homogenen Masse liegt. “Er symbolisiert eine Randfigur der Gesellschaft” (ebd.) und besitzt, aus der Perspektive des taktierenden Feldherren, keine relevanten Individualcharakteristika, weshalb er sich stets als “Kanonenfutter” in vorderster Reihe wiederfindet. Der Wichtigkeit der Figuren wird auch durch ihre absolute Anzahl Rechnung getragen: acht Bauern, jeweils zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer; nur eine Dame und nur ein König, den es überdies zu schützen gilt. Als dem implizit kriegerischem Geschehen enthobener Stratege, mimt der Schachspieler für die Dauer der Partie das oberste Glied der (militärischen) Hierarchie, weshalb davon ausgegangen werden darf, dass sich Schach in einer hegemonialen Atmosphäre entwickelte — “der Kaiser von China hat es gespielt” (Deleuze & Guattari 1992: 483). Mit der Ranghöhe kommt die Verantwortung: “Schicksal” und/oder “Glück” sind Konzepte, die im Zusammenhang des Schachspiels keinen Platz haben.
Das prominente Aufkommen sogenannter "Spielzimmer" (vor allem in der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts) zeugt von der strikten Trennung der Sphären innerhalb der sich entwickelnden Hegemonie. Dem Spiel wird ein expliziter Raum zugewiesen, ebenso wie der Arbeit, dem Essen, dem Schlafen, etc. Mit dieser rigiden Trennung geht eben auch die Wahrnehmung einher, dass alles, was außerhalb bzw. innerhalb eines respektiv designierten Raumes stattfindet auch ein entsprechendes Mindset voraussetzt. Ein Zusammenkommen im Salon unterscheidet sich somit essenziell von einem solchen im Casino und ein solches besitzt schließlich einen fundamental anderen Charakter als eine Zusammenkunft im Arbeitszimmer. Gerade diesem bürgerlich-differentiellen Charakter ist es zuzuschreiben, dass sich so etwas wie explizit ortsgebundene Spielsucht (wie sie unter anderem in Dostojewskijs “Spieler” beschrieben wird) entwickeln kann.

Vom Spielzimmer in den Alltag – Der Siegeszug der Gamification
Gerade in jüngerer Vergangenheit beobachten wir eine regelrechte Profanisierung spielerischer Elemente: Der gerichtete Zugriff auf die von Johann Huizinga behauptete Natur eines “Homo Ludens” (1956) ist ein scheinbar lohnenswertes Unterfangen, das ein gesteigertes Involvement ebenso befördert wie es konzise Erklärungen für gezeigtes Verhalten bereithält. Durch spielerische Intervention wird es zusehends möglich, aktiv auf Menschen und ihre Verhaltensmuster einzuwirken. Eine der Gamification verwandte Spielart eines solchen Kontrollregimes ist etwa das Nudging, bei dem es darum geht, wünschenswerte Handlungen durch zweckdienliche Incentivierung herbeizuführen, jedoch niemals direkt auf das Ziel zu verweisen. Die Nebeneffekte der spielerischen Handlungen sind letzten Endes die wahrhaft wichtigen Aspekte, die zu produzieren das eigentliche Ziel war. Durch clevere Ablenkung gereichen die scheinbaren Abfallprodukte handelnder Subjekte zu den wahrhaft wertvollen Sachverhalten.
Auch wenn eine Auffassung, wie die von Johan Huizinga in dessen Werk Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel vertretene, dass das Phänomen der Kultur erst durch das Spiel gestiftet werde, weil dieses “älter als Kultur” (Huizinga 1956: 9) sei, ein wenig zu weit zu gehen scheint, sollten die psycho-sozialen Implikationen, die mit dem Spielen einher gehen, in Bezug auf kulturelle Entwicklung doch ernstgenommen und weiterhin untersucht werden. Gerade als Übungsfeld, auf dem das Individuum Annahmen über die Welt frei von Konsequenzen erproben kann, kann und muss man dem Spiel eine wichtige Rolle die wahrgenommene Wirklichkeit und Wirksamkeit betreffend attestieren.
Literatur
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1992): Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II. Merve Verlag, Berlin.
Huizinga, Johan (1956): Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Rowohlt Verlag, Hamburg.
Krämer, Sybille (2005): “Die Welt, ein Spiel? Über die Spielbewegung als Umkehrbarkeit.” In: Hantje Cantz Verlag (Hg.) Spielen — Zwischen Rausch und Regel, S. 11-17.
Näher, Ulrike (2014): Zur Geschichte des Glücksspiels.
Serres, Michel (1998): Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemische und Gemenge. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M.
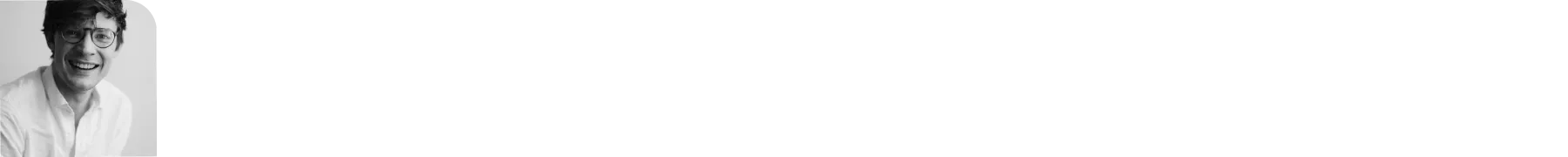
Über den Autor
Jonas ist Kommunikationsexperte und zeichnet sich seinerseits verantwortlich für die sprachliche Darstellung der Taikonauten, sowie hinsichtlich aller öffentlichkeitswirksamen R&D-Inhalte. Nach einiger Zeit in der universitären Forschungslandschaft ist er angetreten, seinen Horizont ebenso stetig zu erweitern wie seinen Wortschatz.