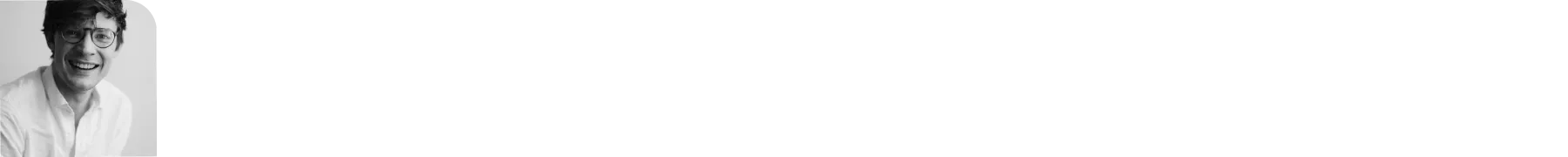Was uns bewegt
– Ein Editorial
von Jonas Kellermeyer
10.04.2025
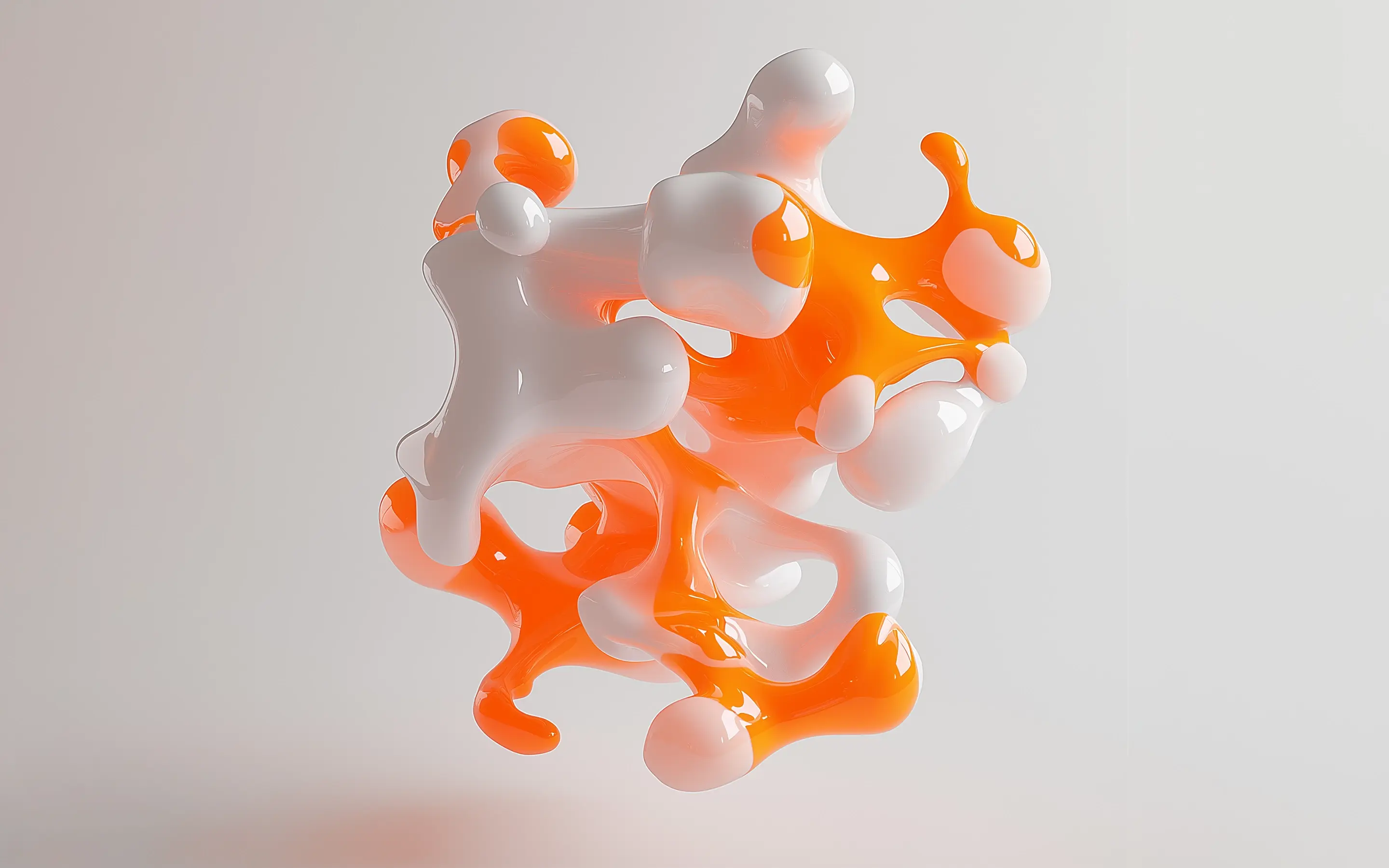
Wir haben ein ausgeprägtes Interesse an der Welt von (über-)morgen. Damit dürften wir zwar nicht allein sein, was uns aber von anderen unterscheidet, ist unser methodologisch geschulter Blickwinkel, der jede unserer der Zukunft zugewandten Bestrebungen rahmt. Wir sind keine x-beliebige Digitalagentur, wir sind Taikonauten!
Wie wir die Zukunft handelnd denken, während wir denkend handeln
Die Zukunft ist kein verchromter Raum, in dem es piept und surrt. Zumindest nicht, wenn man uns fragt. Die Zukunft sieht eigentlich gar nicht so anders aus als wir es von der Gegenwart gewohnt sind. Und doch sind die Funktionen, die sich unter der Oberfläche befinden, einem manifesten Wandel unterworfen. Um Roy Charles Amara zu paraphrasieren: die meisten Menschen tendieren dazu, den Wandel kurzfristig zu über-, seine Auswirkungen langfristig jedoch zu unterschätzen. Wir träumen von fliegenden Autos, Hoverboards und Androiden, die unseren Arbeitsalltag sichtlich erleichtern. Was wir hingegen bekommen sind neue Zeiterfassungstools, Computerprogramme, die wie Piraten zu kommunizieren vermögen und Kühlschränke, die selbstsicher mit Toastern kommunizieren. Alles Veränderungen – sicher – allerdings scheinen diese Innovationen lediglich im Kleinen einen Unterschied zu machen – und selbst hier nur für jene, die sich explizit mit ihnen auseinandersetzen – und die darüber hinaus gewillt sind, den größeren Zusammenhang in den Blick zu nehmen…
Der datafizierte Zusammenhang
Dass sich das Fundament von dem, was wir Gesellschaft schimpfen, sukzessive zu einer Quelle von unschätzbarem Wert transformiert, das entgeht den meisten von uns. Die Datafizierung der gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, ist vielleicht das gewaltigste Wertschöpfungsprojekt der jüngeren Gegenwart. Überall warten schlummernde Potenziale darauf, in eine verwertbare Struktur gepresst zu werden; eine wahrhaft bahnbrechende Erkenntnis folgt allzu häufig erst retrospektiv, hat dann allerdings Auswirkungen auf nahezu jeden Aspekt unserer individuellen Existenz.
Der wahrhaft revolutionäre Wandel entfaltet sich also relativ unaufgeregt im Hintergrund: Wenn man individuellen Datenpunkten weniger Beachtung schenkt, als dem kollektiven Zusammenhang, den diese aus der Vogelperspektive abzubilden im Stande sind, befindet man sich, grob gesprochen, auf dem richtigen Weg.
Die Unsichtbarkeit des Wandels
Das Problem mit der Zukunft ist, dass sie sich selten als radikaler Schnitt präsentiert. Stattdessen sickert sie nahezu unbemerkt in den Alltag ein und vermählt sich mit althergebrachten Routinen. Was sich am Horizont abzeichnet, das bleibt im geschäftigen Alltag oft unbeachtet: Technologien, die einst als revolutionär galten, verlieren ihren Glanz, sobald sie ihren Weg ins gewöhnliche Leben gefunden hat – ein Phänomen, das der Technologiehistoriker Melvin Kranzberg einst treffend als „Gesetz der Banalität des Fortschritts“ beschrieben hat.
Was gestern noch als disruptiv gefeiert wurde, verbleibt heute lediglich als eine infrastrukturelle Realität – kaum beachtet, kaum hinterfragt. Smartphones waren einst ein solches Symbol des Neuen, nun sind sie kaum mehr als die Voraussetzung, um überhaupt am sozialen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Künstliche Intelligenz war ihrerseits lange Zeit so etwas wie der Heilige Gral der Technikforschung, die Verkörperung einer kühnen Vision; heute regelt sie, welche Werbung uns wo angezeigt wird und hilft uns dabei Emails an unsere Vermieter:innen zu formulieren. Der nachhaltige Wandel ist nicht die Sache einzelner Innovationen, sondern eine solche des Geflechts, das sie mit- und untereinander bilden. Ergo: Wahrhafter Wandel geschieht auf einer anderen Betrachtungsebene, als einer solchen, der sich rein phänomenologisch genähert werden könnte.

Handlung ohne Reflexion
Was unterdessen als besonders frappierend in Erscheinung tritt, ist folgender Umstand: Wir glauben, diese Zukunft gestalten zu können, ohne wirklich zu begreifen, wie sehr sie uns selbst gestaltet. Entscheidungen, die in den Vorstandsetagen der großen Tech-Unternehmen oder den entsprechenden R&D-Labs getroffen werden, verändern nicht nur Produkte, sondern mit ihnen auch und gerade die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, denken – und letztlich auch handeln.
Wir installieren Software, ohne ihre Mechanismen zu verstehen. Wir akzeptieren neue Geschäftsmodelle und entsprechende Geschäftsbedingungen, ohne mit der Wimper zu zucken, die mitlaufenden Implikationen letztlich vollends abzuwägen. Wir gewöhnen uns an ein neues Level an Automatisierung, ohne zu hinterfragen, was das für die Vorstellung von wertschöpfender Arbeit bedeuten könnte. Allzu häufig verhält es sich so: Die Zukunft passiert uns – nicht als bewusst gestalteter Prozess, sondern als eine Abfolge von Entscheidungen, die sich erst im Nachhinein als Weichenstellungen für etwas erweisen, das rückgängig zu machen einem regelrechten Kraftakt gleichkommt. Um in einer akzelerierenden Welt das Gleichgewicht und die Kontrolle zu behalten, nicht zu einem Spielball der Umstände degradiert zu werden, bedarf es kühler Köpfe, die sich wagemutig und in ganz und gar professioneller Manier in den Malstrom der Gegenwart begeben, um der Zukunft eine spekulative Form zu geben.
Die Herausforderung der Gegenwart
In einer solchen Handlung steckt die eigentliche Herausforderung: Wie kann man als Teil einer Gesellschaft, die sich als rational und aufgeklärt begreift, die unterschwelligen (technologisch grundierten) Mechanismen ihres eigenen Fortschritts nachhaltig durchdringen? Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass allgemein zu wenig über die Zukunft nachgedacht wird. Im Gegenteil – wir denken unablässig über sie nach, allerdings oft in Bildern, die mehr mit Science-Fiction als mit der Realität zu tun haben. Während wir von humanoiden Robotern und fliegenden Autos träumen, übersehen wir, dass der eigentliche Wandel längst geschieht – und zwar in Form von algorithmischen Systemen, Datenmonopolen und subtilen Verschiebungen der Regeln und Normen dessen, was wir als Zivilisation zu beschreiben geneigt sind.
Die Frage ist also nicht, ob wir die Zukunft kollektiv gestalten, sondern ob wir verstehen, auf welche Weise wir dies tun – und ob wir die richtigen Fragen zu stellen vermögen, bevor die Antworten längst gegeben sind.
Genau dies zu tun, erachten wir als unsere vorrangige Aufgabe. Natürlich geht es darum, unseren Kund:innen neue Wege in Sachen Effizienz- und Produktivitätssteigerung aufzuzeigen. Eine solche Aufgabe ist allerdings niemals losgelöst von der ganzheitlichen Betrachtung einer Gegenwart, die als nahezu vollständig wandelbar in Erscheinung tritt und sich gleichermaßen als regelrechtes Enigma geriert. Um nachhaltig zu helfen muss man zunächst eindringlich verstehen, das ist unsere tiefe Überzeugung. Wenn man sich, wie wir dies tun, voll und ganz der Zukunft verschreibt, kann man Akteuren, die sich dem Hic et Nunc verschreiben, beratend und als strategischer Partner zur Seite stehen.
Hyperstitionale Wendungen
Wenn wir uns den vor uns liegenden Aufgaben und Herausforderungen zuwenden, können wir uns die Frage stellen, aus welcher Richtung wir gemeinhin auf solche blicken. Es scheint logisch zu sein, von Dingen oder Umständen zu sprechen, auf die wir uns zu bewegen. Ein solches Framing gesteht uns eine gestalterische Rolle zu; wir sind die Autoren unserer eigenen Geschichte, die mit jeder Menge Agency bestückt sind und wegweisende Weichenstellungen selbstbestimmt vornehmen.
Eine etwas anders gelagerte Sichtweise bringt das Konzept der Hyperstition mit sich, das seinen Ursprung im theoretischen Arsenal der Akzelerationisten hat. Hyperstitions sind (noch) unaktualisiert verbleibende Potenziale, die uns jedoch im Hier und Jetzt zu beeinflussen vermögen. Fiktion und Realität verschwimmen in ihnen zu einer seltsam wirksamen Melange. Ein schlagkräftiges Beispiel für einen hyperstitionalen Zusammenhang ist etwa in der Raumfahrt zu finden: Die Idee zu den Sternen zu reisen ist im Großen und Ganzen bereits seit Urzeiten Teil des menschlichen Sehnsuchtsrepertoirs: Sie zieht sich durch Fiktion, Wissenschaft und volkstümliche Erzählungen. Der zeitliche Verlauf dieser Hyperstitions besitzt eine ganz eigene Qualität: anders als gemeinhin angenommen, besitzt die Zukunft dieser hochgradig spekulativen Theorie entsprechend die Qualität, ihre Aktualisierung zu forcieren. Wir werden also zu einer solchen hingezogen: Die Zukunft wird paradoxer Weise als realer angenommen, als man es von der Gegenwart sagen könnte.
Weshalb wir uns für derart abgelegene geistige Territorien interessieren? Nun, es liegt in der Natur der Sache, dass man sich als forschende:r Grenzgänger:in in sprichwörtliche Gefahr begeben muss: Um allzeit einen Schritt voraus zu sein, um neue Blickwinkel zu eröffnen, um Wahrnehmungsroutinen zu verändern. Diese Randonné zu wagen, impliziert immer auch das Risiko, sich auf der Suche nach neuen unausgetretenen Pfaden zu verlaufen – die Aussicht entschädigt unterdessen für so einiges.

Fesselnde Insights, die das Publikum begeistern
Was wäre eine exzentrische Forschung wert, wenn sie keine Interessent:innen fände? Um bei allen freidrehenden Ambitionen stets geerdet zu bleiben, ist es ein erklärtes Ziel der Taikonauten, R&D in einer solchen Art und Weise zu betreiben, dass ein solches Unterfangen Anschlussmöglichkeiten generiert. Genauso, wie eine wahrhaft gelungene Fiktion von der “willing suspension of disbelief” (Samuel Taylor Coleridge) lebt, also von einer emotionalen Verbundenheit der Rezipierenden dem Inhalt gegenüber, die denn für die Dauer der Fiktion bereit sind, diese zumindest prototypisch als “Realität” anzunehmen, so sind auch wir darauf angewiesen einen Weg zu beschreiten, der die Öffentlichkeit dazu in die Lage versetzt, gänzlich einzutauchen in die von uns antizipierte Welt von (über-)morgen. Passioniertes Storytelling und methodologisch getriebenes Forschen geben sich die Klinke in die Hand und bitten zum Stelldichein.
Ausblick in eine “Welt von (über-)morgen”
Wer also geneigt ist, sich auf den Pfad zu begeben, den wir anzuskizzieren versuchen, ja, wer sich bisweilen gar kritisch mit ihm auseinanderzusetzen gedenkt, der wird an der regelmäßigen Lektüre unserer Beiträge seine regelrechte Freude haben. Aber auch diejenigen unter euch, denen vor allem an schnell erfassbaren Erkenntnissen gelegen ist, denen ausschweifende Prosa ein Dorn im Auge ist, oder ihr zumindest mit einem genervten Augenrollen begegnen, werden in Zukunft auf ihre sprichwörtlichen Kosten kommen: Es ist nun einmal der Fall, dass Research & Development (R&D) in einem unscharf umrissenen Bereich stattfindet; im Positiven wie im Negativen. Worauf wir es abgesehen haben, ist der Versuch der Eröffnung einer Welt; genauer einer “Welt von (über-)morgen” aus heutiger Perspektive betrachtet. Und dabei geht es uns, wie könnte es anders sein, um die Verschränkung von technologischer Realität mit einer im Wandel begriffenen Soziosphäre.