Quantified Self und Fremd-
bestimmung
von Jonas Kellermeyer
17.04.2025

Als Hintergrund zu unseren derzeitigen R&D-Bestrebungen im Rahmen des Zusammenspiels zwischen Künstlicher Intelligenz und Mixed Reality-Experiences haben wir uns Gedanken zur Bedeutung von Quantified Self-Technologien gemacht.
Wirft man einen Blick auf die konkrete Ausprägung der technologisch durchdrungenen Gegenwart, fällt auf, dass es immer häufiger zu übergriffigem Verhalten technologischer Assistenztechnologien kommt. Von Wearables, die ihre Träger:innen in regelmäßigen Abständen dazu ermahnen, aufzustehen, sich zu bewegen, über TV-Geräte, die sich selbstständig ausschalten, wird die Aktivität der Nutzenden als “zu gering” bewertet, bis hin zu solchen Fitnesstools, die den Schwierigkeitsgrad eines physischen Workouts an die vermeintlich eindeutige körperliche Verfassung des verwendenden Individuums anpassen.
Wie bereits in dieser Einleitung anzuklingen vermag, läuft eine derartig datafizierte Welt Gefahr, zu einem relativ tumben Dystopia zu verkommen. Die Deutungshoheit über so etwas wie “guten Schlaf” oder aber “ausreichend Bewegung” liegt immer stärker in einem Reich der algorithmischen Fremdbestimmung. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Menschheit ungesunde Lebensweisen schönreden konnte; nunmehr liegen alle Zusammenhänge scheinbar offen zutage. Dabei verkennt man zusehends den Fakt, dass das Leben mehr als die Summe seiner Teile ist, also keine noch so akribische Auflistung von Vitaldaten einen kohärenten Sinnzusammenhang anzuzeigen im Stande ist. Im Gegenteil: zeitgenössische Studien verweisen gar auf einen Verlust an Körpergefühl qua Quantified-Self-Mechanismen (vgl. etwa Mau 2017). Wie sollte es auch anders sein? Wenn mein Fitness-Tracker mir mitteilt, dass mein Bewegungsprofil zu wünschen übrig lässt, welcher alternative Schluss zu einer defizitären Lebensweise lässt sich dann ernsthaft ziehen? Uns wird konsequenter Weise ein gänzlich unnummerisches Selbstbewusstsein abtrainiert; die gerissene Lücke wird – mehr oder minder notdürftig – durch allerhand kleine digitale Assistenten gefüllt. Dabei wird die Menge der potenziell gelieferten Daten immer umfangreicher: Von der Sauerstoffsättigung des Blutes, über die Herzfrequenz bis hin zur elektrischen Leitfähigkeit der Haut (Galvanic Skin Response) existieren bislang immer präzisere Daten, die sich, einigermaßen bequem, in einem für die individuelle Nutzer:in persönlich kuratierten chronologischen Verlauf auslesen lassen.
Es existieren grob gesprochen zwei generelle Perspektiven auf das Leben: eine solche ist die, die sich mit der konsequenten Verdatung aller lebensweltlichen Aspekte befasst; das “gute” Leben wird dieser Sichtweise entsprechend aufgefasst als eine Art Rezept, dem zu folgen eine sichere Erfolgsaussicht bereithält. Blicken wir jedoch mit einer wesentlich affektiveren Brille auf derlei Zusammenhänge, fällt auf, dass es schwer möglich, ja, ganz generell sogar wenig wünschenswert ist, derartige Verallgemeinerungen anzulegen. Es mag als gut gemeinter Ratschlag beginnen, à la “Deine derzeitigen Vitaldaten weisen auf eine zunehmende Ermüdung hin. Willst du tatsächlich eine umfassende Trainingssession einlegen?”, was letztlich allzu häufig folgt ist allerdings eine anmaßende Entscheidung, die technologische Systeme an unserer statt treffen – und dabei die menschliche Agency konsequent unterschlagen. Gut gemeint ist eben selten gut gemacht! UX Design sollte sich stets auf den Standpunkt zurückziehen, dass die Erfahrung der Nutzer:innen ganz zentral in ihrer jeweils eigenen Verantwortung liegt.
Die Virtual-Reality-Pädagogik kann etwas zugespitzt “als eine geschlossene, alternativlose Ideologie mit totalitären Tendenzen” (Damberger 2023: 304) beschrieben werden: “Das Ziel einer solchen Pädagogik ist unter anderem die Ermöglichung der Mäßigung als eine zu fördernde Aufgabe der Vernunft, die sich gleichermaßen gegen Unmäßigkeit, Maßlosigkeit und Vermessenheit richtet” (ebd.). Dass ein solches Ansinnen bereits von Grund auf töricht daherkommt, das weiß jeder, der schon einmal irrationaler Weise eine vermeintlich aussichtslose Anstrengung unternommen hat und letztlich als sprichwörtlicher Sieger mit geschwollener Brust hervorging. Risiken einzugehen ist eine menschliche Eigenart, sich und seine eigenen Kräfte dabei kontinuierlich zu überschätzen, geht einher mit einem tiefen Misstrauen aller überbordenden technischen Kontrolle gegenüber.
Das von Gilles Deleuze behauptete Regime der computerischen Kontrollgesellschaften (vgl. Deleuze 1993) steht in einer Tradition der Ohnmachtserzählungen in Relation zu technologischem und technischem Fortschritt und grenzt sich stark ab von der Foucault’schen Disziplinargesellschaft (vgl. Foucault 1975). Ging es in letzterer noch darum, gesellschaftlich “wünschenswertes” Verhalten durch die Androhung empfindlicher Strafen zu erreichen, wird das (allzu) menschlich Defizitäre in der Theorie von Deleuze zum Dreh- und Angelpunkt der Errichtung von rechnergestützter Kontrolle, der man sich sukzessive zu unterwerfen habe. Wo man in der Disziplinargesellschaft niemals wirklich anfängt, da hört man in der Kontrollgesellschaft nie auf zu lernen. Beide Regime bilden ein lebensfeindliches Grundrauschen ab, das jedoch im Falle der rechnerbasierten Kontrolle voll und ganz zur Unterwerfung unter eine datafizierte Hegemonie ausgebaut wird, bzw. werden kann.
In was für einer Welt wir leben wollen, das hängt maßgeblich an unseren Erwartungen an ein geregeltes Zusammenleben. Zwischen einem absolut organischen Vorgehen und vollkommen technokratischen Verfahrensweisen spannt sich so gesehen ein Kontinuum auf, innerhalb dessen sich positioniert werden kann und muss. Es gibt verschiedene Gründe, sich auf die eine oder andere Art und Weise zu entscheiden, doch die jeweiligen Implikationen sollte man im Blick behalten: Misstrauen den jeweils Nächsten und ihren (irrationalen) Beweggründen gegenüber, ist etwa ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Einführung entsprechender Quantifizierungsmechanismen. Es geht “im Kern um die Überführung von Komplexitäten in standardisierte Ordnungsverhältnisse” (Damberger 2023: 305), mit denen sich sicher weiter prognostizieren lässt. Was bei einem solchen Verständnis besonders augenscheinlich wird, ist die antizipierte Habhaftwerdung einer bis dato als unbestimmt bezeichneten Zukunft. Einen möglichst großen Teil dieser Unsicherheit abzubauen ist die grundlegende (und grundsätzlich auch wohl gemeinte) Motivation hinter einer generellen Tendenz zur Vermessung weltender Zusammenhänge. Es geht somit ganz grundlegend darum, der Zukunft ein immer größeres Stück abzuringen, um nicht länger in einem Bereich der Spekulation zu verharren, sondern vielmehr belegbare Fakten zu schaffen. Eine solche Praxis geht allerdings notgedrungen auf Kosten des Lebens im Hic et Nunc, das sich einer Welt im kontingenten Futur I entgegen sieht. Die ihrerseits wiederum hoch spekulative Konplexitätsreduktion im Zeichen der Präemption – also der regelrechten Vorwegnahme anstehender Konsequenzen im Futur II – wird vor allem von wirtschaftlichen Akteuren qua selbstreferentieller Profitorientierung gefordert.
Wollen wir uns, so ließe sich abschließend Fragen, an eine Welt der präemptiven Vermessenheit anschmiegen, oder werden wir uns ihr widersetzt haben? Das zu entscheiden steht und fällt mit der kollektiven Reaktion auf eine Quantifizierung der kleinteiligen, bisweilen gar unscheinbaren Aspekte des ureigensten Privatlebens.
Literatur
Damberger, Thomas (2023): “Vermessung zwischen Erkenntnisgewinn und Überwachung.” In: Mandy Schiefner-Rohs, Sandra Hofhues, Andreas Breiter (Hg.) Datafizierung in der Bildung. Kritische Perspektiven auf digitale Vermessung in pädagogischen Kontexten. Transcript Verlag, Bielefeld, S. 303-322.
Deleuze, Gilles (1993): “Postskriptum über die Kontrollgesellschaften.” In: ders. Unterhandlungen. 1972-1990. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M, S. 254-262.
Foucault, Michel (1975): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M.
Mau, Steffen (2017): Das metrische Wir. Die Quantifizierung des Sozialen. Suhrkamp Verlag, Berlin.
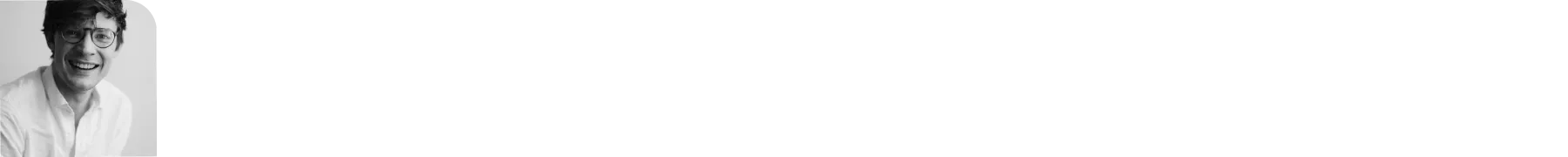
Über den Autor
Jonas ist Kommunikationsexperte und zeichnet sich seinerseits verantwortlich für die sprachliche Darstellung der Taikonauten, sowie hinsichtlich aller öffentlichkeitswirksamen R&D-Inhalte. Nach einiger Zeit in der universitären Forschungslandschaft ist er angetreten, seinen Horizont ebenso stetig zu erweitern wie seinen Wortschatz.